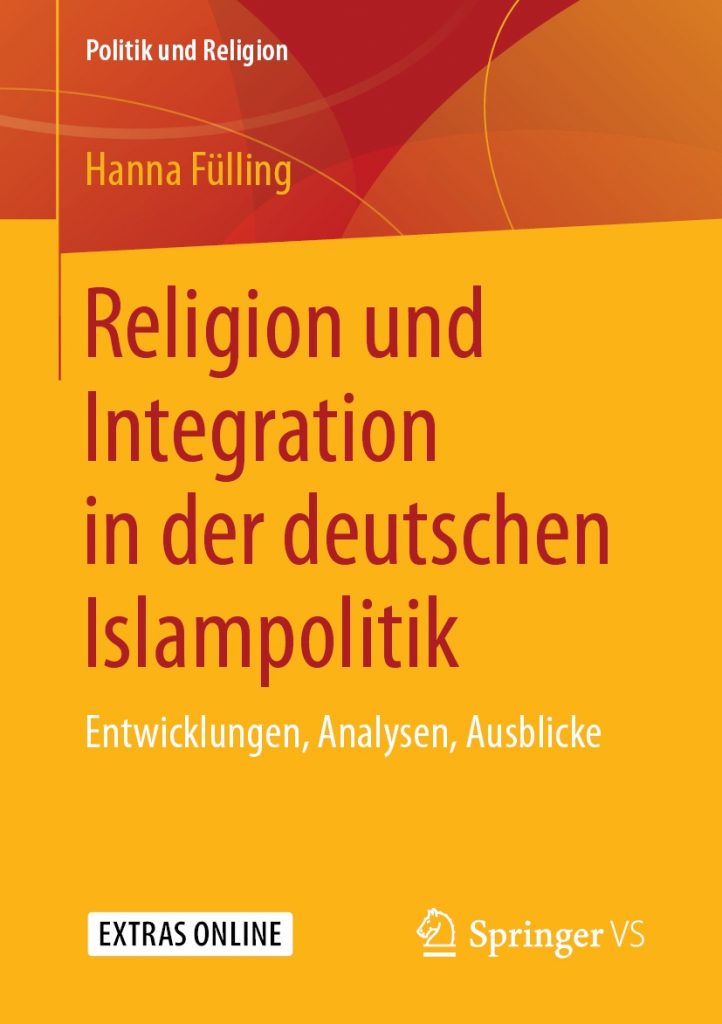„Religionspolitik“ ist in Deutschland erst seit Kurzem ein gesellschaftspolitischer Begriff. Viele Jahre schien das Verhältnis von Staat, Politik und Religion durch das Staatskirchenrecht ausreichend bestimmt. Doch seitdem die Rolle von Religionen in modernisierten Gesellschaften zunehmend kontrovers zwischen den widerstreitenden Narrationen von einer voranschreitenden Säkularisierung auf der einen und dem Wiedererstarken von Religion auf der anderen Seite diskutiert wird, sind vermehrt offene Fragen sichtbar geworden. Sie kulminieren mitunter in einer grundsätzlichen Infragestellung der bestehenden Ordnung.
Die Diagnose einer abnehmenden Bedeutung der Religionen durch voranschreitende Säkularisierungsprozesse wird dabei etwa als Argument eingeführt, um die derzeitige Kooperation von Staat und Religionsgemeinschaften bzw. Kirchen infrage zu stellen oder um eine stärkere (auch strukturelle) Wahrnehmung von Konfessionslosen zu fordern. Letzteres wird häufig von humanistischen Organisationen angeregt, die sich gern als Sprachrohr für die konfessionslose Bevölkerungsgruppe verstanden wissen und ihren Einfluss ausbauen wollen (vgl. Bauer 2016, 232f). Allerdings wird auch die zunehmende religiöse Pluralisierung der Gesellschaft als Argument für eine stärker laizistisch orientierte Religionspolitik herangezogen, da in der Privatisierung von Religion die Lösung zum Umgang mit religiöser Vielfalt gesehen wird. Das Argument lässt sich beispielsweise in der aktuellen Diskussion über das Berliner Neutralitätsgesetz beobachten. Diese Kontroversen haben Auswirkungen auf das Verständnis und die Ausrichtung der Religionspolitik.
Handlungsfeld
Wie umstritten die Bestimmung der Religionspolitik ist, wird beim Versuch deutlich, das Handlungsfeld von Religionspolitik zu definieren. So vertritt etwa der Staats- und Verfassungsrechtler Ernst-Wolfgang Böckenförde die Position, dass mit der Anerkennung der Religionsfreiheit im Grundgesetz alles Notwendige zum Verhältnis von Staat und Religion gesagt sei. Er hinterfragt deshalb, ob es eine staatliche Religionspolitik überhaupt geben dürfe oder ob nicht jede Einmischung des Staates in die Freiheit und Unabhängigkeit der Religionsgemeinschaften eine Verletzung der Trennung von Staat und Religion darstelle. Religionspolitik wird von Böckenförde demnach als Verteidigung der Religionsfreiheit beschrieben. Er fokussiert sich dabei vor allem auf die Grenzen von Religionspolitik, indem er die Trennung von Staat und Kirche als leitendes Prinzip zugrunde legt. Dass allerdings auch diese Funktionsbeschreibung von Religionspolitik politische und rechtliche Aushandlungsprozesse und Entscheidungen erforderlich machen kann, wird spätestens dann deutlich, wenn die Religionsfreiheit mit anderen Grundrechten in Konflikt gerät oder wenn die Freiheit von der Religion (negative Religionsfreiheit) gegen die Freiheit zur Religion (positive Religionsfreiheit) in Stellung gebracht wird.
Die daraus resultierende Prozesshaftigkeit von Religionspolitik berücksichtigt der Politikwissenschaftler Ulrich Willems in seiner Bestimmung von Religionspolitik. Er definiert sie „als all jene Prozesse und Entscheidungen, in denen die religiöse Praxis von Individuen einschließlich ihrer kollektiven Ausdrucksformen sowie der öffentliche Status, die Stellung und die Funktionen von religiösen Symbolen, religiösen Praktiken und Religionsgemeinschaften in politischen Gemeinwesen geregelt werden“ (Willems 2001, 137). Willems‘ Definition schließt aktuelle Debatten über Religionsunterricht, den Umgang mit religiösen Symbolen in staatlichen Einrichtungen (Kreuz, Kopftuch etc.) und religiösen Ritualen und Praktiken (z. B. Beschneidung, Bestattungen, Feiertage) sowie die Anerkennung von religiösen und weltanschaulichen Gruppierungen als Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und die Verleihung des Körperschaftsstatus mit ein. Den sich aus diesen Diskussionen und Anträgen ergebenden anhaltenden Steuerungs- und Aushandlungsbedarf bettet Willems allerdings nicht in die religions- und verfassungsrechtlichen Vorgaben des Grundgesetzes ein. In seiner Definition deutet sich damit eine Offenheit für die Aushandlung der normativen Grundlagen der Religionspolitik an.
Der Politikwissenschaftler Antonius Liedhegener betrachtet diesen Ansatz skeptisch und sieht die Gefahr, dass der politischen Regulierung von Religion hierdurch ein zu großer Handlungsspielraum eingeräumt werde. Er beschreibt Religionspolitik als eine Kombination aus den religions- und verfassungsrechtlichen Grundlagen mit den fortlaufenden juristischen und politischen Entscheidungen und administrativen Festlegungen, die aus dem anhaltenden Regelungsbedarf im Feld der Religionspolitik resultieren. Er betrachtet den Aushandlungsbedarf nicht als ungewöhnlich, da es ihn in gewissem Umfang zu jeder Zeit gegeben habe.
In Liedhegeners Bestimmung wird zudem das besondere Zusammenspiel von rechtlicher und politischer Regulierung deutlich, das für die Religionspolitik in Deutschland charakteristisch ist. Die Komplexität dieses engen Zusammenspiels steigert sich noch dadurch, dass die deutsche Religionspolitik verschiedene Instanzen in Bund, Ländern und Kommunen tangiert. Während im Bund Fragen des Religionsverfassungsrechts in grundsätzlicher Art, Aspekte des Tierschutzes sowie Fragen des Arbeits- und Betriebsverfassungsrechts entschieden werden, haben die Länder die Kultushoheit und bestimmen etwa über den Religionsunterricht. In den Kommunen werden hingegen vor allem Herausforderungen gelebter Religiosität ausgetragen (interreligiöser Dialog, Moscheebau etc.).
Rechtliche und politische Grundlagen
Die einzelnen Bestimmungen des deutschen Religionsverfassungsrechts fußen auf Art. 4 GG, dem Recht auf Glaubens-, Bekenntnis- und Gewissensfreiheit sowie auf der Versicherung, dass die ungestörte Religionsausübung gewährleistet wird. Ergänzt wird es durch Art. 7 GG, in dem der Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach in den Schulen (mit Ausnahme von bekenntnisfreien Schulen) kodifiziert wird. Grundlegende Bestimmungen zum Religionsverfassungsrecht bilden zudem die Art. 136-141 der Weimarer Reichsverfassung (WRV) von 1919, die in Art. 140 GG inkorporiert wurden. In diesen Artikeln werden sowohl Trennungs- als auch Verbindungslinien zwischen Staat und Religion fixiert. So wird im Art. 137 WRV, Abs. 1, festgelegt, dass es keine Staatskirche gibt und dass Religionsgesellschaften ihre Angelegenheiten innerhalb der Schranken des geltenden Rechts selbständig ordnen und verwalten. Die Trennung zwischen Staat und Religion schützt sowohl die Hoheitsmacht des Staates vor religiösen Übergriffen als auch die Religion vor staatlichen Machtansprüchen und Vereinnahmungen.
In Deutschland ist diese Trennung allerdings nicht laizistisch, sondern kooperativ ausgerichtet und zeichnet sich demnach durch ein kontrolliertes Aufeinanderbezogensein aus. Dies drückt sich etwa in Art. 141 WRV, in der Möglichkeit zur Militär-, Gefängnis- und Krankenhausseelsorge, aus sowie in Art. 137 WRV, Abs. 5 und 6, mit der Möglichkeit für Religionsgemeinschaften, sich als Körperschaften des öffentlichen Rechts zu organisieren und beispielsweise Steuern zu erheben. Religionen werden in diesen Bestimmungen als Akteure des öffentlichen Lebens anerkannt und dafür vom Staat gefördert. Als solche übernehmen sie Aufgaben in der Gesellschaft. Dies zeigt sich besonders deutlich in der Arbeit von Organisationen wie Caritas, Diakonie und der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Der Staats- und Kirchenrechtler Hans Michael Heinig fasst die Vorteile des Religionsverfassungsrechts darin zusammen, dass die destruktiven Potenziale von Religion eingehegt und ihre sozialproduktiven Kräfte stimuliert werden (vgl. Heinig 2018, 21).
Religion wird jedoch nicht nur ein Beitrag zur Funktionalität und Gestaltung der Gesellschaft, sondern auch zu ihrer Sinnstiftung attestiert. Diese ist Böckenförde zufolge für den freiheitlichen, säkularisierten Staat essenziell, da er „von Voraussetzungen [lebt], die er selbst nicht garantieren kann“. Böckenförde äußerte diesen Satz in einem Text des Jahres 1967 und stellte damit zum einen ein zentrales Wagnis eines freiheitlichen Staates heraus und versuchte zum anderen, Christen dazu zu ermutigen, ihren Platz im säkularen Rechtsstaat einzunehmen. Eine modifizierte Neuauflage erfuhr dieses Argument durch den Sozialphilosophen Jürgen Habermas, der die Gefahr hervorhebt, dass sich der Staat durch einen vorschnellen Ausschluss von religiösen Argumenten aus dem öffentlichen Diskurs wichtiger Anregungen und Sinnressourcen berauben könnte.
Einschätzung
Die im Religionsverfassungsrecht festgelegte kooperative Trennung von Staat und Religion basiert auf einer „respektvolle[n] Nicht-identifikation des Staates“ (Bielefeldt 2007, 77). Strukturell übersetzt sich dieser Grundsatz in Deutschland darin, dass die Kooperationsmöglichkeiten zwischen Staat und Religion prinzipiell allen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zugänglich sind. Auch wenn der Staat aufgrund von Traditionen, historischen Entwicklungen und des kollektiven Gedächtnisses der Gesellschaft unterschiedliche Grade von Nähe, Kooperation und Distanz zu verschiedenen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften aufweist, stellen die religionspolitischen Grundlagen ein gutes Grundgerüst zum Umgang mit religiösem und weltanschaulichem Pluralismus dar.
Die religiöse und weltanschauliche Neutralität des Staates dient dabei als kritisch-normatives Prinzip, durch das bewusste oder nicht bewusste Diskriminierung angezeigt und ausgleichende Veränderungsprozesse angeregt werden können. Wichtig ist, dass sich die Nicht-Identifikation in den staatlichen Strukturen manifestiert, Parität gewährleistet ist und die Kooperationsmöglichkeiten somit auch tatsächlich allen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften offen stehen. Dass Änderungen und neue Kooperationen politischer Aushandlungen bedürfen und auch gesellschaftspolitische Diskussionen und Kontroversen hervorrufen können, belegen zahlreiche aktuelle religionspolitische Debatten über Religions- und Weltanschauungsunterricht, über religiöse Symbole im öffentlichen Raum sowie über die Kooperationen und Verträge zwischen Staat und Religionsgemeinschaften.
Die Dynamik solcher religionspolitischer Prozesse wird am Beispiel der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Kopftuch von Lehrerinnen in öffentlichen Schulen besonders deutlich: Während das Bundesverfassungsgericht 2003 entschieden hatte, dass die Bundesländer ein Kopftuchverbot von Lehrerinnen in öffentlichen Schulen erteilen können, wenn eine hinreichend bestimmte Grundlage besteht, wies das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung im Jahr 2015 als verfassungswidrig zurück und bestimmte stattdessen, dass ein solches Verbot nur zulässig ist, wenn der Schulfrieden nachweislich gestört wurde.
Die bestehenden religionsverfassungsrechtlichen Bestimmungen sind im Grundsatz dafür geeignet, solche Kontroversen zu lösen und den Regelungsbedarf auszuhandeln. Diese Einschätzung vertritt auch eine Mehrheit der parteipolitischen Akteure (vgl. von Scheliha 2018, 133). Ein laizistischerer Kurs findet dagegen vor allem in Teilen von Bündnis 90/Die Grünen sowie Teilen der Linken und der FDP Zustimmung.
Am deutlichsten ist er aber in der AfD ausgeprägt. Sie fordert in ihrem Wahlprogramm für die Landtagswahl in Bayern 2018 die Ablösung der Staatsleistungen, die Auflösung der Staatskirchenverträge, die Unterbindung des Kirchenasyls sowie die Verdrängung religiöser (islamischer) Symbole und Rituale aus dem öffentlichen Raum. Experten, wie Ulrich Willems, sehen in solchen Forderungen, die nicht mit dem Freiheitsrecht der Religionsfreiheit vereinbar sind, auch ein Resultat der Zögerlichkeit politischer Entscheidungsfindung (vgl. Willems 2018, 15).
Die Veränderungen der Gesellschaft seit 1919 und 1948 machen eine intensive Debatte über das Handlungsfeld von Religionspolitik, über Anpassungen und über eventuelle Neuerungen erforderlich. Ein gewisser Veränderungs- und Ausgleichsbedarf sollte von den politischen Akteuren nicht ignoriert, sondern gemeinsam mit religiösen und weltanschaulichen Akteuren diskutiert werden. Denn nur auf diese Weise kann die Integrationskraft des bestehenden Religionsverfassungsrechts auch unter den Bedingungen einer sich zunehmend religiös und weltanschaulich pluralisierenden Gesellschaft gewährleistet werden. Zudem sollte Religionspolitik Räume schaffen, in denen Kritik an und zwischen den Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften artikuliert werden kann und eine (auch kritische) Verständigung ermöglicht wird, durch die Diskussionen in Extremen und ein vereinfachender Dualismus vermieden werden.
Der Artikel entstand als Stichwort der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) und wurde erstmalig im Materialdienst der EZW veröffentlicht. Dieser Artikel und weitere zum Thema sind auf der Website abrufbar: www.ezw-berlin.de
Quellen
Bundesverfassungsgericht (BVerfG): BVerfG 2 BvR 1436/02, 2003
Bundesverfassungsgericht (BVerfG): BVerfG 1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10v), 2015
Alternative für Deutschland (AfD): Bayern. Aber sicher! Wahlprogramm Landtagswahl Bayern 2018, Nürnberg 2018
Sekundärliteratur
Bauer, Michael: Kooperative Laizität. Herausforderungen der deutschen Religionspolitik aus Sicht des Humanistischen Verbandes Deutschlands, in: Thörner, Katja / Thurner, Martin (Hg.): Religion, Konfessionslosigkeit und Atheismus, Freiburg i. Br. 2016, 225-246
Bielefeldt, Heiner: Menschenrechte in der Einwanderungsgesellschaft. Plädoyer für einen aufgeklärten Multikulturalismus, Bielefeld 2007
Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Notwendigkeit und Grenzen staatlicher Religionspolitik, in: Thierse, Wolfgang (Hg.): Religion ist keine Privatsache, Düsseldorf 2000, 173-184
Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Der säkularisierte Staat, München 2007
Habermas, Jürgen: Vorpolitische Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates?, in: Habermas, Jürgen / Ratzinger, Joseph: Dialektik der Säkularisierung, Bonn 2005, 15-37
Heinig, Hans Michael: Staat und Religion in Deutschland. Historische und aktuelle Dynamiken im Religionsrecht, in: APuZ 28-29/2018, 16-21
Liedhegener, Antonius: Das Feld der Religionspolitik – ein explorativer Vergleich der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz seit 1990, in: Zeitschrift für Politik (ZfP), 61/2 (2014), 182-208
Scheliha, Arnulf von: Zwischen christlicher Leitkultur und Laizismus. Zur religionspolitischen Willensbildung der Parteien in Deutschland, in: Gerster, Daniel / van Melis, Viola / Willems, Ulrich (Hg.): Religionspolitik heute. Problemfelder und Perspektiven in Deutschland, Freiburg i. Br. 2018, 116-138
Willems, Ulrich: Religionspolitik in der Bundesrepublik Deutschland 1945 – 1955. Die politische Regulierung der öffentlichen Stellung von Religion und Religionsgemeinschaften, in: ders. (Hg.): Demokratie und Politik in der Bundesrepublik Deutschland: 1945 – 1999, Opladen 2001, 137-162
Willems, Ulrich: Stiefkind Religionspolitik, in: APuZ 28-29/2018, 9-15